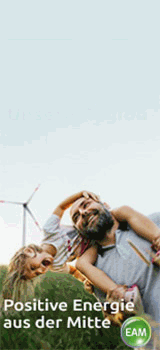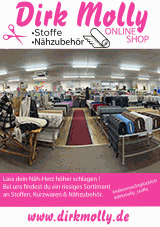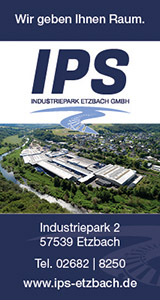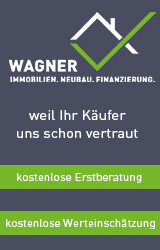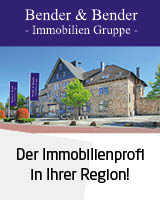Neues Ehrensoldgesetz: Auch im AK-Land profitieren ehemalige Wahlbeamte
Nicht überall auf Gegenliebe gestoßen ist die Änderung des Ehrensoldgesetzes in Rheinland-Pfalz, die am 1. Januar wirksam wurde. Demnach erhalten pensionierte Wahlbeamte wie beispielsweise ein Bürgermeister einer Verbandsgemeinde unter bestimmten Voraussetzungen nunmehr monatlich bis zu 1000 Euro zusätzlich.

Kreis Altenkirchen/Mainz. Das ist so eine Sache mit dem neuen Ehrensoldgesetz, das die Landesregierung in Mainz um 1. Januar in Kraft gesetzt hat: Bislang galt, dass der Anspruch auf Ehrensold ruhte, solange jemand als Beamter oder Arbeitnehmer hauptberuflich im öffentlichen Dienst beschäftigt war. Das betraf im Regelfall die Ortsbürgermeister. Dieser Ruhenstatbestand wurde nunmehr gestrichen. Ehrensold und Besoldung können jetzt gleichzeitig bezogen werden. Darüber hinaus tat sich auch für ehemals hauptamtlich tätige Bürgermeister von Verbandsgemeinden (VG), die parallel ehrenamtliche Stadtbürgermeister waren, eine neue Geldeinnahmequelle auf. Bei Ende der Wahlzeit wurde im Anschluss nur die Pension als Bürgermeister einer VG gezahlt (je nach Einwohnergröße zwischen 6000 und 7500 Euro/brutto). Ein Ehrensold als ehrenamtlicher Stadtbürgermeister wurde nicht zusätzlich gewährt. Mit den neuen Vorgaben haben ehemalige Bürgermeister einer VG nun aber Anspruch auf Ehrensold. Damit erreiche allein die Erhöhung, durchaus bis zu 1000 Euro, ungefähr die Durchschnittsrente in Deutschland, bringen Kritiker vor. Entgegen der Gesetzesbegründung handele es sich nach Auffassung der Mäkler nicht um die Stärkung des Ehrenamtes, sondern stelle eine Klientelpolitik dar. „Wenn die Landesregierung erklärt, dass durch eine Änderung des Ehrensoldgesetzes das ehrenamtliche Engagement gestärkt wird, wird hierbei verschwiegen, dass dies nur am Rande passiert. In erster Linie erhalten durch die Gesetzesänderung vor allem viele hauptamtliche Bürgermeister eine erhebliche Verbesserung ihrer Alterssicherung. In Rheinland-Pfalz dürfte es Hunderte von zukünftigen und bereits aktuellen Anspruchsberechtigten geben“, argumentiert das Lager derjenigen, die die Gesetzesänderung für nicht gut heißen können. Den Ehrensold müssten die Kommunen über die Grundsteuer finanzieren, die ohnehin für die Bürger eine hohe Belastung darstelle. Wer die Neugewährung des Ehrensoldes für angemessen erachte, müsse es auch als angemessen ansehen, wenn der nunmehr gewährte Ehrensold durch die Grundsteuer von Familien, Geringverdienern, Alleinerziehenden und Rentnern bezahlt werde. Selbst kleine Gemeinden könnten mit Beträgen im fünfstelligen Bereich belastet werden. Der Ehrensold beträgt nach einer Amtszeit von insgesamt zehn Jahren 25 Prozent, nach einer von insgesamt fünfzehn Jahren sowie bei Dienstunfähigkeit, wenn diese beim Ausscheiden aus dem Amt bereits eingetreten war, 33,3 Prozent der jeweiligen Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätig gewesene Bürgermeister (Staffelung je nach Einwohnerzahl der Stadt/Ortsgemeinde von 350 bis 2937 Euro).
Verbesserung für Berufspolitiker
„Politik und Gesellschaft diskutieren einerseits über eine Anhebung des Renteneintrittsalters, das Rentenniveau und die steigende Gefahr der Altersarmut, und andererseits wird eine erhebliche finanzielle Verbesserung für ehemalige Berufspolitiker vorgenommen. Es fehlt Geld für Schwimmbäder und Krankenhäuser, aber nicht für einen neuen Ehrensold. Bei den Mitarbeitern der Verwaltungen wird die neue Regelung zu einem hohen Frust führen. Seit Jahren wird bei Besoldungsdiskussionen oder im Rahmen der Tarifverhandlungen von den Verantwortlichen Zurückhaltung gefordert. Man gehe bei den Zugeständnissen an die Grenze des Möglichen. Das ist jetzt nicht mehr glaubhaft“, wird ergänzend argumentiert. Die Änderung des Ehrensoldgesetzes sei auch keineswegs nur für die Zukunft gedacht. Profitieren sollten alle, selbst diejenigen, die bereits längst nicht mehr im Amt seien. Wenn die Landesregierung schon eine solche Änderung vornehme, sollte sie nicht die Stärkung des Ehrenamtes vortäuschen, sondern sagen, was es wirklich sei: eine Klientelpolitik für Wahlbeamte, die durch die Grundsteuer zu bezahlen sei. Es bestehe durchaus die Sorge, dass die Akzeptanz weiter Bevölkerungskreise verloren gehe und sich die tatsächliche, durchaus an Lebensrealitäten orientierende, Bewertung der Begrifflichkeiten von „zeitgemäß“ und „angemessen“ durch die Bürger im Gesetzesentwurf nicht widerspiegele.
Stellenanzeige

|
Mitarbeiter/-innen (m/w/d) im Betreuungsverein der AWO Altenkirchen e.V. Betreuungsverein der AWO Altenkirchen |
„Dank und Anerkennung“
Natürlich sei es rechtlich unzweifelhaft, dass der Ehrensold nicht als (zusätzliche)
Versorgungsleistung zur Sicherung der Lebensführung des ehemaligen Ehrenbeamten gedacht sei, sondern mit ihr „Dank und Anerkennung des Gemeinwesens“ für die geleisteten langjährigen Dienste als ehrenamtlicher Bürgermeister zum Ausdruck gebracht würden. „Es ist aber wenig hilfreich, mit rechtstheoretischen Ansichten zu argumentieren. Einem schwindenden Vertrauen in die Demokratie mit einem einhergehenden Trend zu radikaleren Ansichten kann nur mit einer sachgerechten und fairen Politik begegnet werden. Ob das Gesetz diesem Anspruch genügt, ist zweifelhaft“, legen Gegner weiter dar. Nach den „alten“ Vorgaben des Ehrensoldgesetzes ruhte der Anspruch auf Ehrensold, solange die oder der Berechtigte als Beamtin oder Beamter oder Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer hauptberuflich im öffentlichen Dienst beschäftigt ist. Aus Gründen der Gleichbehandlung mit den in der Privatwirtschaft Beschäftigten sollte der Ruhenstatbestand für hauptberuflich im öffentlichen Dienst Beschäftigte
aufgehoben werden. Diese Benachteiligungsvermutung der Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes gegenüber den Beschäftigten in der Privatwirtschaft werde in der Öffentlichkeit nicht geteilt. Vielmehr sei Realität, dass verbreitet nur öffentlich
Beschäftigte oder nicht (mehr) am Arbeitsleben teilnehmende Menschen für ein
Bürgermeisteramt zur Verfügung stünden. Die tatsächlichen Zahlen belegten dies auch. Es zeige sich, dass nur etwa ein Drittel der Bürgermeister in der Privatwirtschaft, aber bei geringer Gesamtzahl ein Viertel im Öffentlichen Dienst tätig seien. Handwerker und Landwirte stellten mit sechs Prozent eine Minderheit dar. Auffallend sei mit 27 Prozent ein hoher Anteil an ehrenamtlichen Bürgermeistern, die nicht erwerbstätig seien. Innerhalb der Gruppe der nicht-Erwerbstätigen machten Rentner und Pensionäre mit 79 Prozent die größte Gruppe aus.
Desaströse Wirkung?
Weitere Tadel werden angeführt: „Hauptamtliche Bürgermeister erhalten bereits eine Pension, die um ein Vielfaches höher als die Rente ist und das nach deutlich weniger Dienstjahren. Bei Beamten der Besoldung B 4 (ab 20.000 Einwohner) bis B 6 (ab 40.000 Einwohner) beträgt die monatliche Bruttopension, sofern die entsprechend erforderlichen Dienstjahre erreicht werden, zwischen 6600 und 7500 Euro. Dies soll nicht in Zweifel gezogen werden und ist auch sicher begründbar. Nicht begründbar ist aber die weitere Besserstellung durch die Gesetzesänderung. Die Anhebung der finanziellen Entlohnung, wie auch immer die Bezeichnung oder Herleitung begründet werden mag, die einer Durchschnittsrente nahekommt oder übersteigt, ist nicht angemessen. Sofern dies in der Bevölkerung wahrgenommen wird, könnte die Wirkung desaströs sein. Bei den Mitarbeitern der Verwaltungen kann diese Regelung zudem zu einem hohen Frust führen. Seit Jahren wird bei Besoldungsdiskussionen oder im Rahmen der Tarifverhandlungen von den Verantwortlichen Zurückhaltung gefordert. Man geht bei den Zugeständnissen an die Grenze des Möglichen. Die Beschäftigten werden feststellen müssen, dass es durchaus entscheidend ist, auf welcher Seite der Grenze sie sich befinden.“ (vh)
Lokales: Altenkirchen & Umgebung
Feedback: Hinweise an die Redaktion